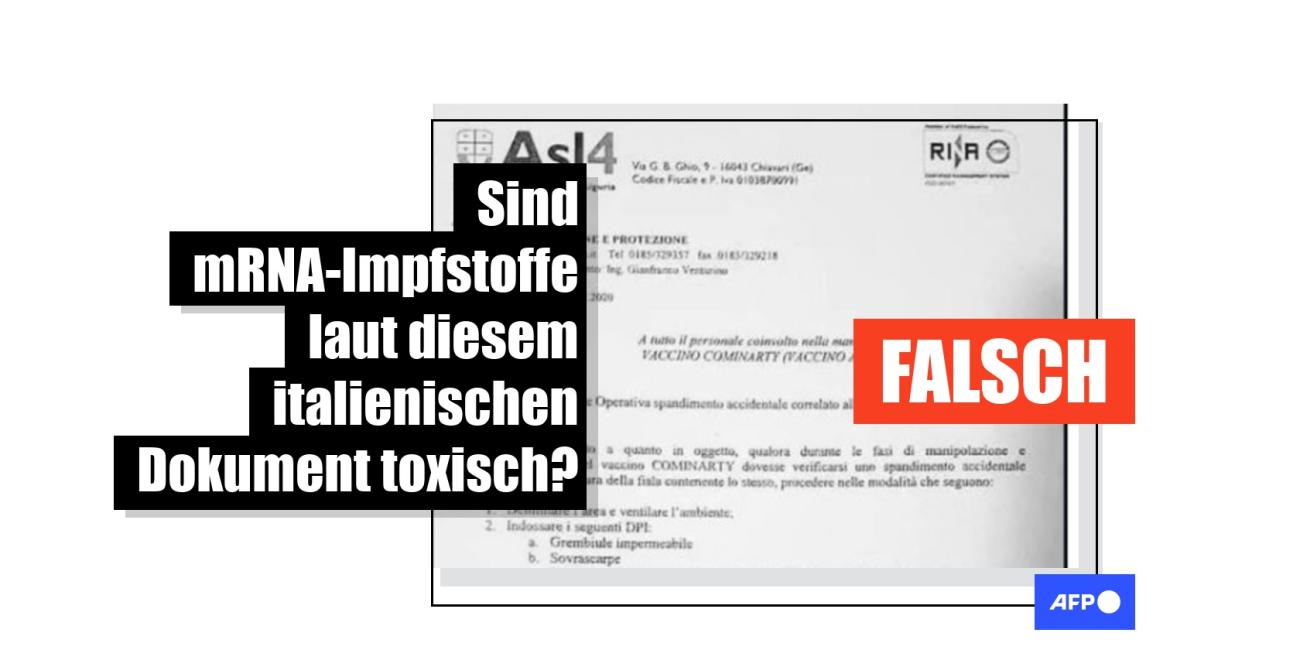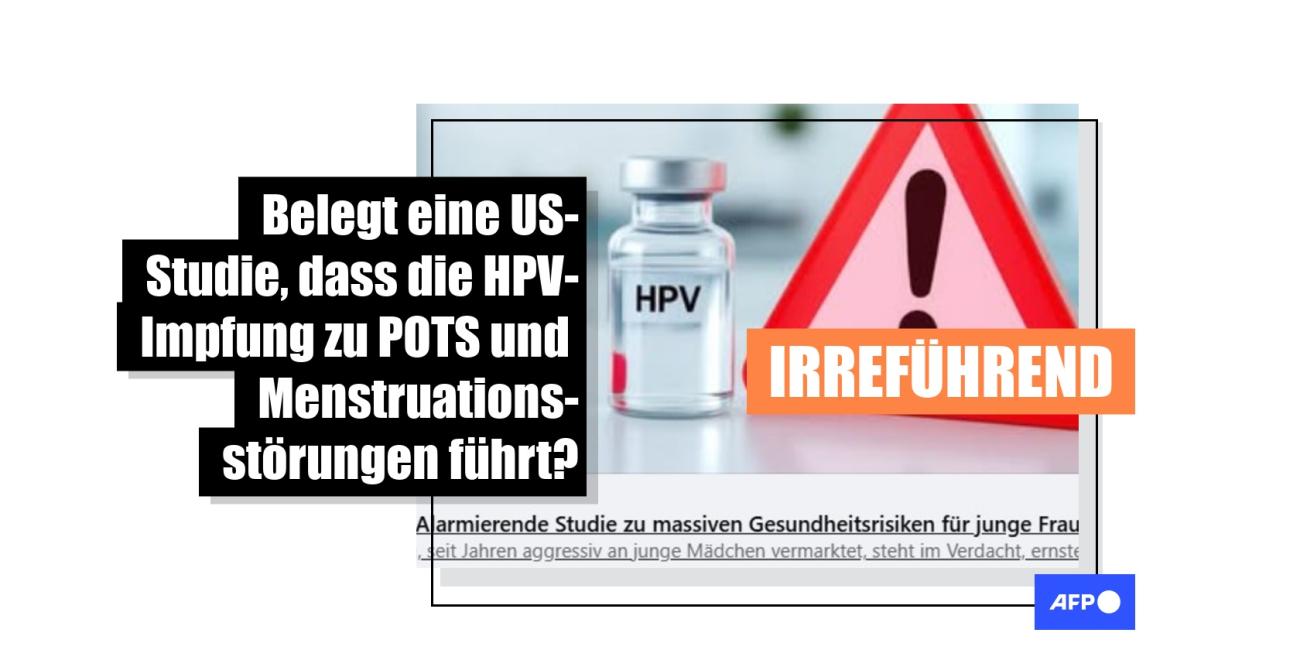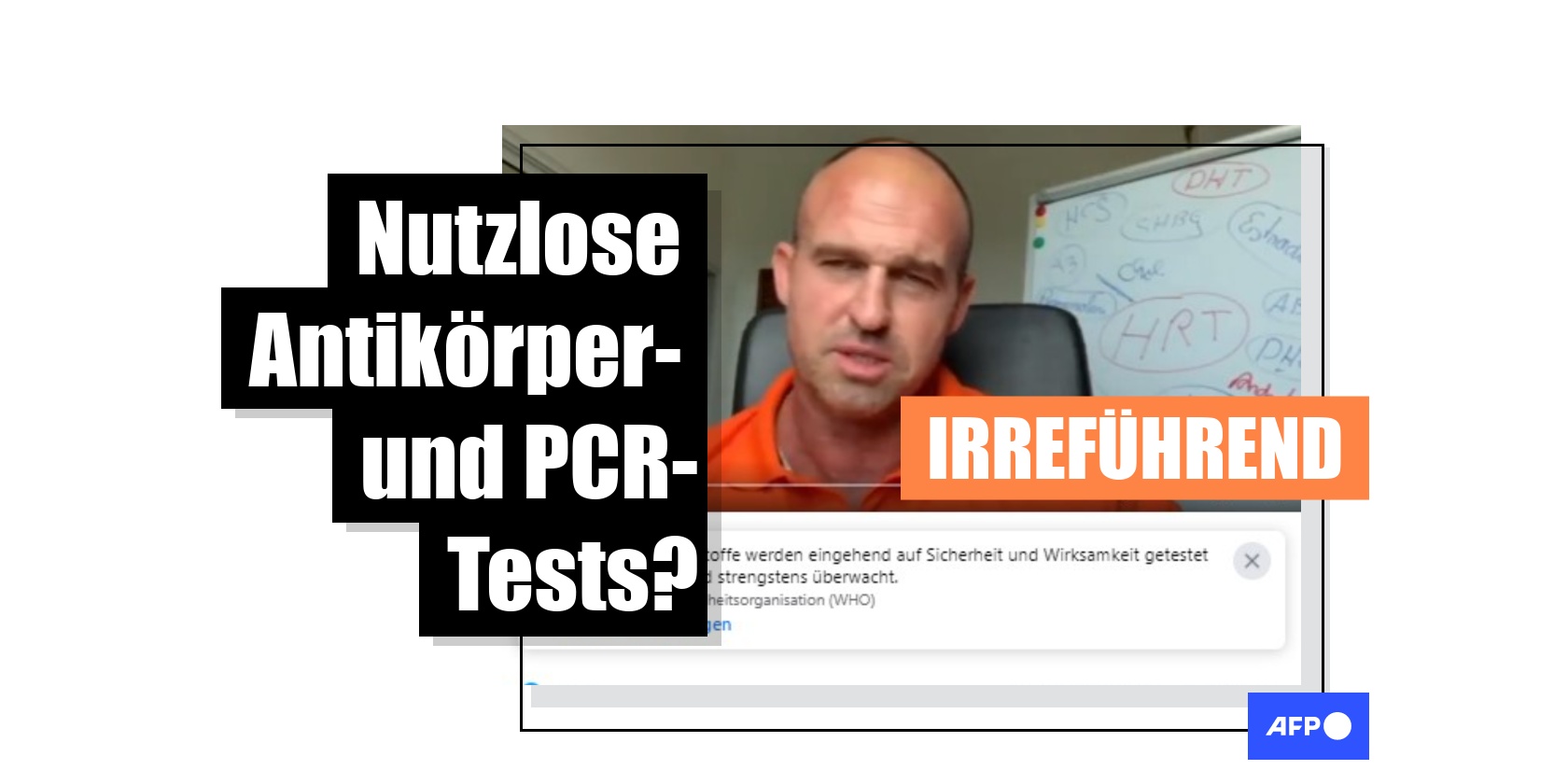
Dieses Video verbreitet irreführende Aussagen über PCR-Corona-Tests und die Wirkung von Impfungen
- Dieser Artikel ist älter als vier Jahre.
- Veröffentlicht am 9. November 2021 um 15:47
- 6 Minuten Lesezeit
- Von: Saladin SALEM, AFP Deutschland
Tausende Nutzerinnen und Nutzer haben das Video mit den Behauptungen zu PCR-Test und Stiko auf Facebook geteilt (hier). Auch auf Telegram sahen Tausende eine ähnliche Behauptung (hier).
Die Falschbehauptung: Der Sprecher des Videos auf Facebook stellt sich selbst als Arzt vor. Er behauptet, dass PCR-Tests keine Infektionen oder Erkrankungen nachweisen könnten. Mittels PCR sei es unter den richtigen Bedingungen möglich, alles nachzuweisen, was an DNA und RNA-Fragmenten in der Testsubstanz enthalten sei, behauptet er weiter. Zudem empfehle die Stiko keine Prüfung des Impferfolgs der Covid-19-Impfstoffe. Für Geimpfte seien daher keine "serologischen Korrelate" definiert, also kein Richtwert für den Antikörperspiegel.
Es könne dadurch kein Schwellenwert angegeben werden, ab welchem von einem sicheren Schutz ausgegangen wird. Auf Telegram heißt es zudem, es seien nach den Impfungen keine Antikörper messbar.
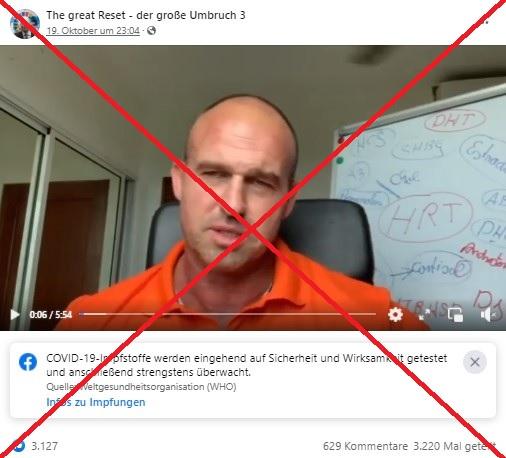
Wie funktionieren PCR-Tests?
Kritikerinnen und Kritiker von Corona-Maßnahmen verbreiten immer wieder falsche Behauptungen über PCR-Tests. Mal seien diese nicht zum Nachweis des Coronavirus geeignet, mal seien die Tests gar nicht erst zugelassen oder könnten nicht zwischen Grippe- und Coronaviren unterscheiden. Alle diese Behauptungen hat AFP bereits in der Vergangenheit widerlegt (hier, hier, hier).
Der PCR-Test beruht auf einer Polymerase-Kettenreaktion, oft mit PCR abgekürzt, und ist ein häufig verwendetes Testverfahren, um den Virus Sars-CoV-2 im Körper nachzuweisen. Dabei wird das genetische Material aus einer Rachenprobe vervielfältigt. Ist der Erreger darin enthalten, weist der PCR-Test dessen genetische Spuren nach.
Ein Video der Uniklinik Aachen erklärt die Schritte eines PCR-Tests genauer:
Internationale Expertinnen und Experten sind sich über die Wirksamkeit von PCR-Tests einig. In diesem Faktencheck von Oktober bestätigten etwa das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC) und ein Forscher der argentinischen Vereinigung der Virologen die Wirksamkeit der Tests.
Die Schweizer Gesundheitsbehörde weist außerdem in einem Merkblatt explizit darauf hin, dass mit einem PCR-Test "auf eine SARS-CoV-2-Infektion geschlossen werden" kann. Weiter heißt es: "Mit dieser sehr empfindlichen Methode wird in Patientenproben spezifisch die Nukleinsäure eines Erregers nachgewiesen, was eine Infektion mit dem Erreger belegt." (Mehr dazu auch hier)
AFP hatte zu dieser Frage bereits Ende September 2020 das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) kontaktiert. Sprecherin Ronja Wenchel sagte damals, das die Genauigkeit der PCR-Tests wegen ihrer Funktionsweise und ihrer Qualität sehr hoch sei. Wenchel erklärte: "Sie liegt bei korrekter Durchführung und Bewertung bei nahezu 100 Prozent."
Der PCR-Test weist dabei die Infektion eines Patienten nach, nicht aber, ob dieser auch infektiös, also ansteckend ist. Trotz hoher Sicherheit kann der PCR-Test außerdem unter Umständen auch falsche Ergebnisse liefern, was die Gesundheitsämter aber in ihrer Strategie berücksichtigen. Expertinnen und Experten erklärten diese bereits hier gegenüber AFP.
Zur Möglichkeit, mit dem PCR-Verfahren beliebige DNA und RNA-Fragmente nachzuweisen, erläuterte Prof. Thomas Böttcher vom Institut für Biologische Chemie der Universität Wien am 16. Oktober gegenüber AFP: "Bei sehr vielen PCR-Zyklen kann man irgendwann auch ein einzelnes Molekül einer Nukleinsäure so weit amplifizieren, dass es detektierbar ist. Aber: Üblicherweise werden nicht so viele Zyklen durchgeführt."
Das bestätigte auch Prof. Christof R. Hauck, Biologe an der Universität Konstanz, am 17. Oktober gegenüber AFP: "In der Tat könnte man theoretisch ein einziges Virengenom mittels PCR nachweisen. Diese enorme Sensitivität ist es ja, was die Polymerase-Kettenreaktion so wertvoll macht. Aber leider ist die Sensitivität in der Praxis nicht ganz so hoch, denn die PCR beruht auf Enzymen, die zwar sehr robust sind, aber keine unbegrenzte Lebensdauer und Funktionsfähigkeit haben." Es gebe somit ein Detektionslimit, eine Vervielfältigung ins Unendliche sei also nicht möglich.
Um das Sars-CoV-2-Genom in einer biologischen Probe nachweisen zu können, vervielfältigt das für den Test verwendete Gerät im Labor das genetische Material in einer festgelegten Anzahl von Durchgängen bei unterschiedlichen Temperaturen: Diese Vervielfältigungen werden als Amplifikationszyklen bezeichnet, sie sind ein wesentlicher Bestandteil des PCR-Tests. Muss man viele solche Wiederholungen vornehmen, um das Virus-Erbgut nachzuweisen, bedeutete das eine niedrigere Viruslast. Reichen nur wenige Wiederholungen, befindet sich eine große Menge Viren im Körper.
Dieser Schwellenwert, ab wie vielen Wiederholungen ein Test positiv ausfällt, heißt "Cycle Threshold" oder abgekürzt CT-Wert. Er ist von angewendetem Gerät zu angewendetem Gerät unterschiedlich. Das macht es für die Gesundheitsämter unmöglich, sich auf eine allgemeingültige Anzahl von Zyklen festzulegen. Das Robert Koch-Institut verweist beispielsweise auf eine Zahl von 31 bis 34 Zyklen, hält aber auch fest, dass auch in Proben mit einem Schwellenwert von über 35 noch replikationsfähige Viren nachweisbar sind: "Dies verdeutlicht, welch große Varianz sich bei Verwendung des Ct-Wertes aus den verschiedenen Testsystemen ergibt."
Für das Robert Koch-Institut gilt der PCR-Test als "Goldstandard" der Diagnostik des Coronavirus. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bezeichnen solche Labortests ebenfalls als "Goldstandard des klinisch-diagnostischen Nachweises von Sars-CoV-2".
Die Empfehlungen der Stiko
Im Facebook-Video heißt es, die Ständige Impfkommission empfehle nicht, den Impferfolg der Covid-19-Impfstoffe zu prüfen. Es gebe keinen Schwellenwert, bei welchem von einem "sicheren Schutz" ausgegangen werden könne.
Tatsächlich heißt es im Epidemiologischen Bulletin 39/2021 der Stiko:
"Wie auch bei anderen Impfungen ist es bei der Covid-19-Impfung grundsätzlich nicht angezeigt, den Impferfolg mittels Antikörpertestung zu überprüfen. Auch bei immundefizienten Personen, bei denen eine 3. Impfstoffdosis verabreicht werden soll, sollte nicht in jedem Fall nach Abschluss des regulären Impfschemas eine serologische Untersuchung durchgeführt werden."
Es existiert demnach auch kein Richtwert für Antikörperkonzentrationen, ab dem von einem ausreichenden Schutz ausgegangen werden kann (mehr dazu hier). Neben den neutralisierenden Antikörpern, böten auch das angeborene und das zelluläre erworbene Immunsystem einen Schutz vor Infektionen und Erkrankungen.
“Die SARS-CoV-2-spezifische zelluläre Immunantwort kann jedoch in den meisten Diagnostiklaboren nicht ohne Weiteres untersucht werden,” erläutert die Stiko weiter.
Das Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam (IMD) erläutert auf seiner Webseite, eine "Bewertung von Antikörper-Ergebnissen in Bezug auf das Vorhandensein oder die Dauer einer Immunität" könne aktuell aufgrund ausstehender klinischer Studien nicht erfolgen. Getestete könnten aber individuell feststellen, ob eine Bildung von Antikörpern nach der Impfung stattgefunden hat.
Des Weiteren heißt es: "Die mRNA-Impfstoffe scheinen eine sehr hohe Antikörperantwort zu induzieren, die im Durchschnitt sogar höher als nach einer Wildvirus-Infektion liegt."
Eine Ausnahme zur Antikörpertestung sind laut Stiko Menschen mit einer schweren Immundefizienz, also einer starken Schwäche des Immunsystems. Bei den Betroffenen müsse davon ausgegangen werden, dass nur eine ungenügende oder keine Antikörperbildung stattgefunden hat. In diesen Fällen könne per Diagnostik festgestellt werden, ob überhaupt eine Immunantwort auf den Impfstoff ausgelöst wurde.
Antikörper sind in der Regel nach der Impfung nachweisbar
Der Sprecher des Videos auf Facebook kommt zu dem Schluss, die "Antikörper-Theorie" stehe auf wackeligen Beinen. (Zur Erklärung: Gemeint ist die Annahme, dass nach der Impfung Antikörper entstehen.) Der Impferfolg sei nicht überprüfbar. Auf Telegram heißt es auf Grundlage der Stiko-Sätze sogar, die Antikörper seien nach der Impfung gar nicht messbar.
Prof. Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbands Deutscher Laborärzte, erläuterte auf AFP-Anfrage am 4. November in einem Telefonat: "Es gibt ganz klar eine Antikörperbildung nach der Impfung. Der Neutralisationstest ist der Beweis dafür, dass diese neutralisierenden Antikörper da sind."
Solche Plaque-Reduktions-Neutralisationstests (PRNT), also Tests, die nachweisen, ob eine Schutzwirkung durch die Antikörper vorliegt, können nach Angaben des IMD aber nur in virologischen Speziallabors durchgeführt werden, da diese einen erhöhten Sicherheitsstandard erfordern.
Auch Bobrowski erläutert, für die Tests seien Hochsicherheitslabore notwendig, daher seien diese nicht in großen Mengen durchführbar. Dabei müssten lebendige Viren auf Zellkulturen gebracht werden, die diese zerstören. Das Serum der getesteten Patienten würde dann mit Hilfe der Antikörper diese Zerstörung stoppen.
Insgesamt sind laut Bobrowski bei Geimpften deutlich weniger schwere Verläufe zu beobachten als bei Ungeimpften. "Das ist ja ein Beweis dafür, dass hier eine Immunisierung und damit ein Impferfolg stattgefunden hat", erklärte er.
Florian Krammer, Immunologe und Impfforscher an der Icahn School of Medicine des Mount-Sinai-Krankenhauses in New York erläuterte ebenfalls im Rahmen eines Faktenchecks am 21. Juni: "Die Impfstoffe induzieren eine sehr starke neutralisierende Antikörperreaktion. Auch die nicht-neutralisierenden Antikörper, die ebenfalls induziert werden, können in vivo eine starke Schutzwirkung haben." Kramer und einige Kolleginnen und Kollegen untersuchten die Antikörper-Produktion nach Impfungen dafür in einer Studie.
Mehrere Studien zeigen zudem die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen schwere Fälle von Covid-19 auf. Laut einem am 23. September 2021 veröffentlichten Covid-19-Impfstoff-Überwachungsbericht von Public Health England deuten die jüngsten Schätzungen darauf hin, dass in England durch das Impfprogramm über 230.800 Krankenhausaufenthalte direkt verhindert wurden" und ebenso "zwischen 23,7 und 24,1 Millionen Infektionen und zwischen 119.500 und 126.800 Todesfälle" verhindert werden konnten.
Eine Studie der Universität von Indiana und der RAND Corporation, die am 18. August 2021 in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlicht wurde, schätzt zudem, dass die Impfung bis Mai 2021 fast 140.000 Todesfälle in den Vereinigten Staaten verhindert habe. Eine weitere, im Juli 2021 veröffentlichte Studie unter der Leitung der Yale School of Public Health kommt zu dem Ergebnis, dass "die koordinierte und schnelle COVID-19-Impfkampagne, die Ende letzten Jahres in den Vereinigten Staaten gestartet wurde, etwa 279.000 Leben gerettet und 1,25 Millionen Krankenhausaufenthalte verhindert hat."
Fazit: PCR-Tests können eine Infektion mit Sars-CoV-2 nachweisen. Die Stiko empfiehlt tatsächlich generell keine Antikörpertestung nach der Impfung, weil die Durchführung kompliziert ist und keine genauen Richtwerte für Antikörperkonzentrationen formuliert sind. Ausnahmen bestehen bei Menschen mit Immundefizienz. Experten und Studien bestätigen allerdings die Existenz einer Antikörperreaktion nach der Impfung.
Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.