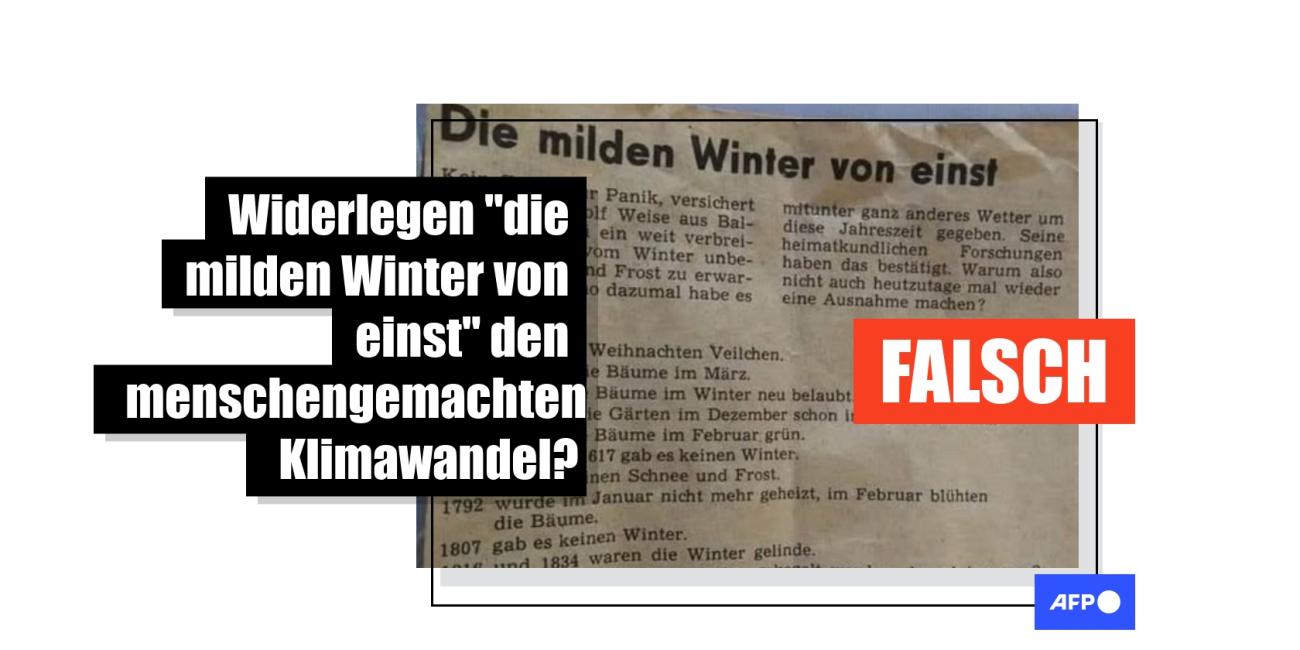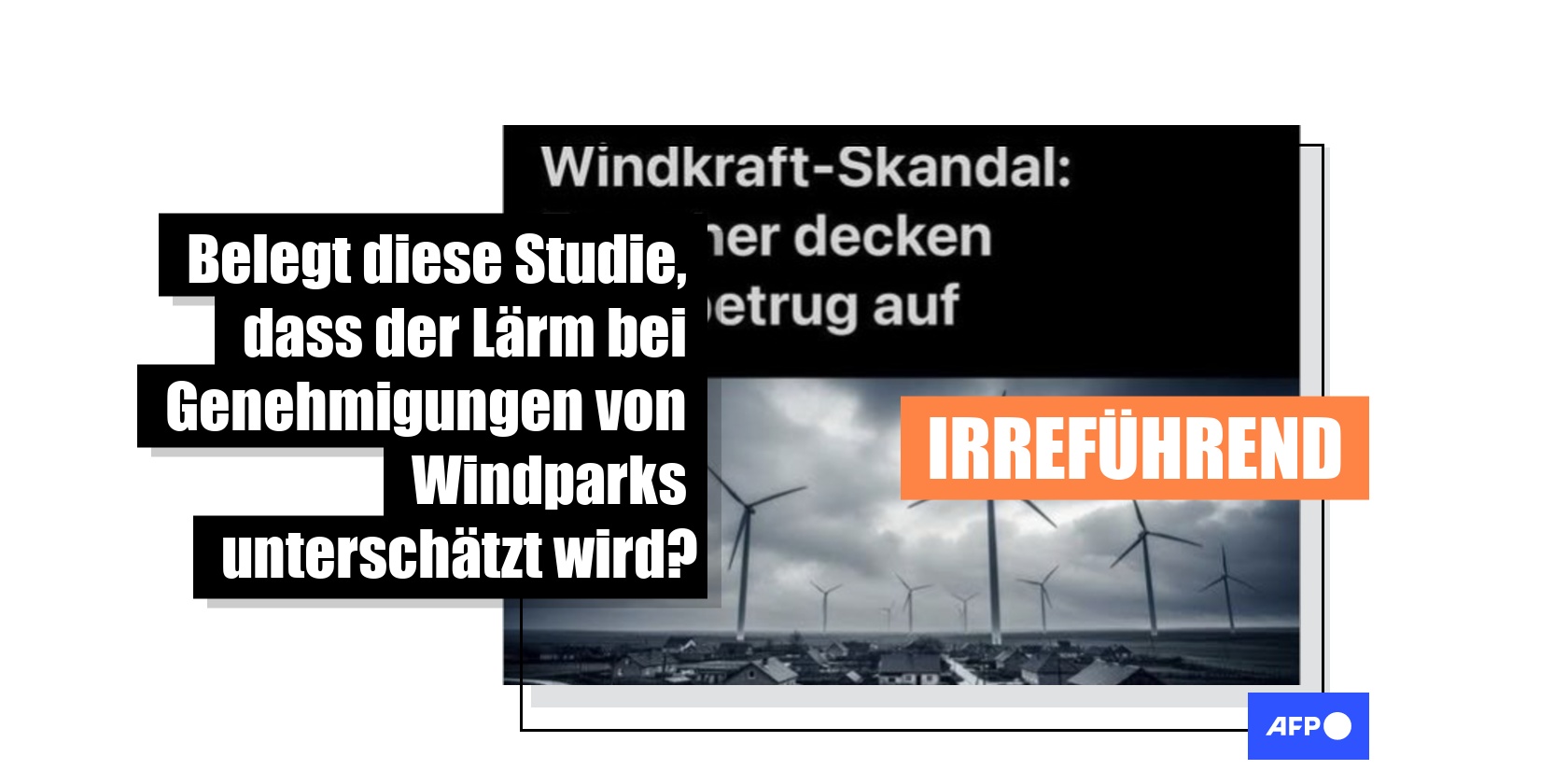
Geräusche durch Windparks: Studie kein Beweis für "physikalisch unhaltbare" Genehmigungsverfahren
- Veröffentlicht am 28. November 2025 um 18:15
- 6 Minuten Lesezeit
- Von: Elena CRISAN, AFP Österreich
Die Nutzung von Windkraft erfolgt nicht geräuschlos. Auf sozialen Plattformen wird jedoch behauptet, eine neue Studie würde bestätigen, dass offizielle Lärmbewertungen für Windkraftanlagen auf "fehlerhaften und physikalisch nicht haltbaren Modellen" beruhen. Userinnen und User sprechen von "Windkraft-Skandal" und "Lärmbetrug". Fachleute betonten jedoch, dass Windparks in der Realität leiser seien als in Genehmigungsverfahren angenommen. Der Hauptautor der Studie bestätigte zudem selbst, dass die Posts seine Studie missinterpretieren und sie keine Rückschlüsse auf behördliche Lärmbewertungen zulässt.
Die Landschaft wirkt bedrohlich: Über einer Siedlung mitten auf einem verregneten Feld steigen dunkle Wolken auf. Hinter den Häusern ragen mehrere Windräder empor. Im Zusammenhang mit einem online geteilten Bild, das laut Beschreibung mithilfe von Künstlicher Intelligenz generiert wurde, ist von einem "Skandal" und "Lärmbetrug" die Rede. "Forscher decken Lärmbetrug auf ", lautet ein Facebook-Beitrag vom 21. Oktober 2025 mit mehreren hundert Shares. Weiter heißt es: "Eine neue wissenschaftliche Untersuchung belegt, dass offizielle Lärmgutachten für Windräder auf fehlerhaften und physikalisch unhaltbaren Modellen beruhen." Die "tatsächliche Geräuschbelastung für Anwohner" würde "systematisch unterschätzt" werden. Nun könnten "viele Genehmigungen" von Windparks rechtswidrig sein.

Mehrere Online-Portale griffen die genannte Studie auf. Report24 stellte in der Vergangenheit andere Behauptungen auf, die AFP untersuchte. Auf dem Blog hieß es am 16. Oktober 2025, eine neue Studie würde untermauern: "Lärmberechnungen, auf deren Grundlage Windräder genehmigt werden, sind ganz offensichtlich fehlerhaft und in der Praxis völlig unbrauchbar." Tkp, ein österreichischer "Blog für Science & Politik", der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Falschinformationen auffiel, die AFP widerlegte, schrieb am 29. Oktober 2025: "Veraltete Lärmnormen bringen Betreiber, Projektierer und Behörden auf die Anklagebank." Gängige Vorschriften würden "den Schall einzelner Rotoren unter idealisierten Bedingungen" messen und "reale Schallwerte" seien "deutlich höher als Modelle annehmen", schrieb Blackout News am 22. Oktober 2025. Hierbei handelt es sich um einen Blog, dessen Behauptungen ebenfalls bereits Gegenstand von AFP-Faktenchecks waren.
Fachleute, darunter auch die Studienautorinnen und -autoren selbst, bestätigten allerdings, dass die Interpretation der Studie online unzutreffend ist. Die Studie entspreche laut Fachleuten dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Das reicht jedoch nicht aus, um Genehmigungsverfahren rechtlich in Frage zu stellen. Die erwähnten Blogbeiträge unterschlagen, dass es sich bei der Studie um eine wissenschaftliche Simulation handelt – und nicht um reale Messungen.
Studienautor distanzierte sich von Behauptung
Die Studie trägt den Titel "Modeling wind farm noise emission and propagation: effects of flow and layout" (zu Deutsch: "Modellierung der Lärmemission und -ausbreitung von Windparks: Auswirkungen von Strömung und Anordnung"). Sie erschien am 18. August 2025 im Journal "Renewable Energy" und untersucht etwa, wie die Anordnung von Windenergieanlagen die Geräuschausbreitung eines Windparks beeinflusst. Sie zeigt beispielsweise, dass der Nachlauf, also die Windschleppe hinter einem Windrad, stromaufwärts gelegener Turbinen, einen gewissen Einfluss auf die Geräuschemissionen stromabwärts gelegener Turbinen haben kann. Auf die stromaufwärts gelegenen Turbinen trifft der Wind zuerst auf. In der Abwärtsströmung dahinter ist die Windgeschwindigkeit geringer.
AFP stand mehrmals mit dem Hauptautor der Studie, Jules Colas, in Kontakt. In einer Stellungnahme schrieb er am 7. November 2025: "Nein, unsere Studie suggeriert in keiner Weise, dass die Lärmgutachten zu Regulierungszwecken unzulänglich oder physikalisch unhaltbar sind." Colas erzählte in einem weiteren Telefonat am 12. November 2025, er habe seine "Doktorarbeit über die Ausbreitung von Windturbinenlärm geschrieben" und sich im Zuge seines Studiums an der École Centrale in der französischen Großstadt Lyon mit dem Lärm von Windkraftanlagen beschäftigt.
"In unserer Studie zeigen wir, dass bestimmte Strömungsdynamiken, die in technischen Modellen normalerweise nicht berücksichtigt werden, einen Einfluss auf die Geräuschausbreitung haben können, insbesondere stromabwärts eines Windparks." Dies habe "jedoch keinen Einfluss auf das Regulierungsverfahren oder die Messungen". Colas sagte, dass Feldmessungen erforderlich seien, "um nachzuweisen, dass die von uns vorgestellten Effekte in realen Szenarien eine signifikante Wirkung haben". Gleichzeitig befürwortete der Forscher, dass die Regulierungsvorschriften sich "mit neuen Erkenntnissen über die Ausbreitung von Windkraftanlagenlärm weiterentwickeln sollten".
Die Studie wurde von Fachkolleginnen und -kollegen noch nicht kritisch gegengelesen, so Colas. Im Gespräch mit AFP betonte er zudem, dass er und sein Team von den Autorinnen und Autoren der Blogbeiträge mit der irreführenden Behauptung "nie kontaktiert" wurden.
Wie der Lärm in der Praxis bestimmt wird
"Die Ausbreitung von Schall hängt von vielen Faktoren ab", erklärte Po Wen Cheng, Leiter des Lehrstuhls für Windenergie an der Universität Stuttgart, am 23. November 2025. Dazu zählt der Professor beispielsweise eine Reihe von Faktoren: Erdoberfläche, Bodenrauigkeit, Vegetation, Turbulenz, Stabilität der Atmosphäre, Temperatur, Layout des Windparks. "Diese Komplexität kann die zitierte Studie auch nicht abbilden." Jede Studie könne nur einen Teilaspekt berücksichtigen.
"Die Schallerzeugung durch Windenergieanlagen ist gut dokumentiert und wird bei allen neuen entwickelten Anlagen vermessen", sagte Cheng. Es sei falsch, dass "Lärmgutachten für Windräder auf fehlerhaften und physikalisch unhaltbaren Modellen beruhen", sagte auch Christian Fabris, Leiter des Fachbereichs für Lärm beim Umweltbundesamt (UBA), am 6. November 2025 im Gespräch mit AFP. Genehmigungsverfahren würden eine "gute Studienlage" berücksichtigen, bestätigte auch er.
Fabris erklärte weiter, dass die Studie auf einer Simulation beruhe, die keine realen Windparkbedingungen widerspiegeln würde. Dies widerspreche Behauptungen, wonach "Lärmberechnungen, auf deren Grundlage Windräder genehmigt werden, offensichtlich fehlerhaft und völlig unbrauchbar in der Praxis seien". Die Studie beschäftige sich "nicht mit in der Praxis gemessenen Werten". Fabris sagte zudem, dass Lärm außerhalb des zumutbaren Bereichs, wie er auch gesetzlich festgelegt ist, "im Genehmigungsverfahren auffallen" würde und Behörden "keinesfalls wegschauen" würden. Vielmehr seien Vorschriften konservativ gehalten: "Gutachterinnen und Gutachter schätzen den von Windenergieanlagen ausgehenden Lärm also lauter ein, als er in der Praxis ist."
Das sei in Österreich ähnlich, wie Teamleiter für Akustik Matthias Wozel vom technischen Planungsbüro EWS Consulting im Gespräch mit AFP am 11. November 2025 sagte. EWS habe laut eigenen Angaben an rund der Hälfte aller Windkraft-Projekte in Österreich mitgearbeitet. Wozel widersprach den Behauptungen ebenfalls. Er erklärte, dass die rotierenden Rotorblätter "Hauptverursacher der Geräuschemission von Windenergieanlagen" seien. Untergeordnet würden auch die Emissionen von Getriebe oder dem Generator eine Rolle spielen. Die Formeln zur Ermittlung der Schallimmissionen für Genehmigungsverfahren seien in der Praxis zwar "deutlich einfacher" als in solchen Forschungsvorhaben, "sie berücksichtigen jedoch so viele Sicherheiten, dass sie eine Worst-Case-Situation darstellen".
Cheng erklärte, dass viele Windenergieanlagen nachts mit gedrosselter Leistung laufen würden, um die vorgeschriebenen Immissionswerte einzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt in Europa einen Wert von 45 Dezibel (dB). "Dies wird erreicht, indem man die Drehzahl und damit auch die Blattspitzengeschwindigkeit reduziert." Tagsüber gelten – je nach Gebiet – höhere Grenzwerte. In den meisten Fällen liegen Windparks in einem Mischgebiet, das auch für Wohnungen genutzt werden kann, wo in Deutschland etwa ein Grenzwert von 60 dB gilt.
Lärmprognosen unterliegen zudem rechtlichen Kriterien. Diese sind laut deutschem Immissionsschutzgesetz in der Verwaltungsvorschrift TA Lärm und in Österreich nach DIN ISO 9613-2 geregelt. Laut UBA sind derzeit keine neuen Regelungen für Genehmigungsverfahren in Deutschland geplant.
Cheng wies darauf hin, dass die Immisionswerte von Windenergieanlagen bei Beschwerden gemessen werden. Betreiberinnen und Betreiber von Windenergieanlagen müssen Maßnahmen ergreifen, um die gesetzlich vorgeschriebene Werte einzuhalten.
Kurzzeitige Geräuschanstiege sind Herausforderung
Die online geteilte Studie beschäftigt sich unter anderem mit einem Phänomen, das Amplitudenmodulation genannt wird. Dabei erhöht sich kurzzeitig die Lautstärke der Windenergieanlage und schwillt wieder ab – "etwa alle zwei bis fünf Sekunden in Abhängigkeit der Rotordrehzahl", erklärte Wozel.
Diese Schwankung kann als störend empfunden werden, wie das UBA im Jahr 2022 bei 463 Anwohnenden untersuchte. Wozel sagte, dass ein "andauerndes und gleichbleibendes Hintergrundgeräusch" wie von einer stark befahrenen Autobahn von "Anrainerinnen und Anrainern subjektiv als weniger belästigend wahrgenommen werden" als ein Windpark, obwohl dieser "insgesamt leiser" sei. Amplitudenmodulation sei laut Wozel zudem nicht durchgehend hörbar. "Das Phänomen tritt unter bestimmten meteorologischen Gegebenheiten (Windrichtung und -geschwindigkeit) auf."
Wozel erklärte, dass Amplitudenmodulation in Genehmigungsverfahren weder in Deutschland noch Österreich berücksichtigt werde. Allerdings gelte in Österreich ein genereller Sicherheitszuschlag von 3 dB, der auch für Geräusche wie Amplitudenmodulation vergeben werde.
Forschung arbeitet an Lösungen
Die Schallleistung von Windkraftanlagen sei relativ konstant geblieben, obwohl diese "deutlich größer sind als vor zehn Jahren", sagte Cheng von der Universität Stuttgart. Das habe etwa mit der Drehzahl der Windenergieanlagen zu tun: "Die großen Anlagen drehen langsamer als die kleinen Anlagen."
Cheng versicherte, dass die Hersteller von Windturbinen versuchen würden, durch technische Verbesserungen, Schall zu reduzieren. Während es zwar Herausforderungen wie die Amplitudenmodulation gebe, arbeite die Forschung daran, "die Phänomene besser zu verstehen, um effektive Lösung zu entwickeln". "Wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann werden die Methoden in den Richtlinien wie DIN aktualisiert", so Cheng.
Fazit: Online wurde behauptet, dass Genehmigungsverfahren von Windparks laut einer Studie "fehlerhaft und physikalisch unhaltbar" seien. Doch der Hauptstudienautor sowie weitere Fachleute erklärten, dass diese Interpretation irreführend sei. Windparks seien in der Realität leiser als in Genehmigungsverfahren angenommen. Von Windparks verursachter Lärm sei zudem eine Herausforderung, die bei deren Genehmigung berücksichtigt werde.
Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.