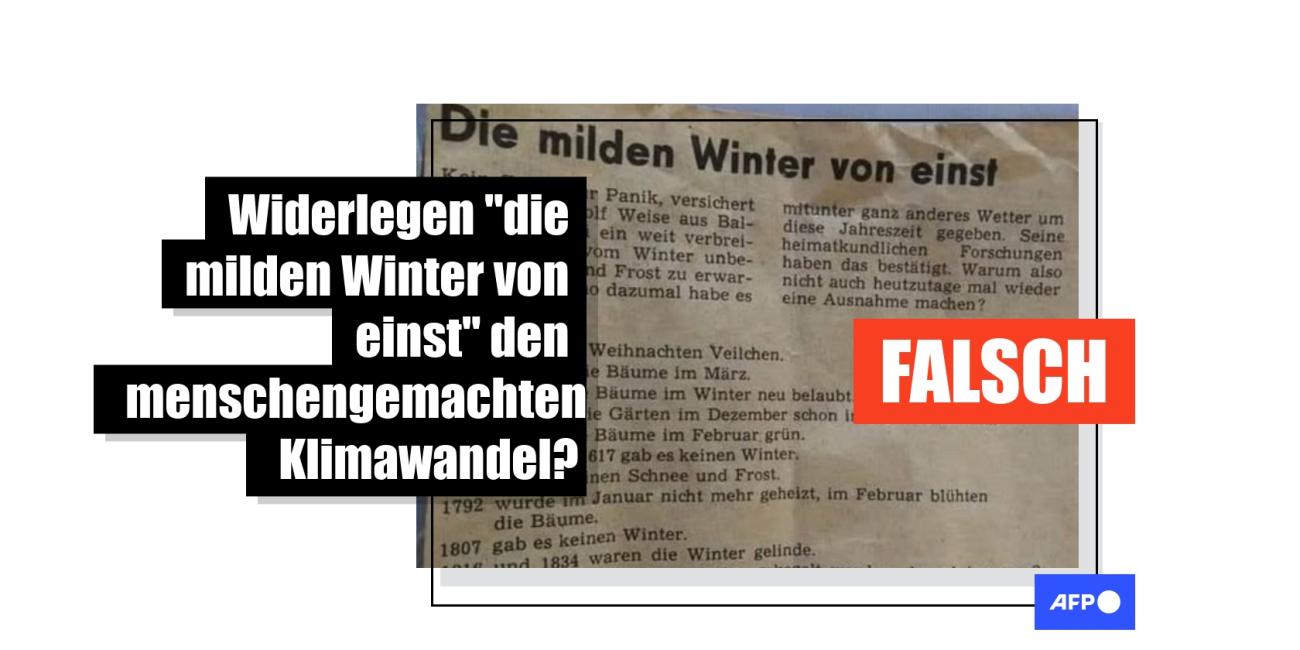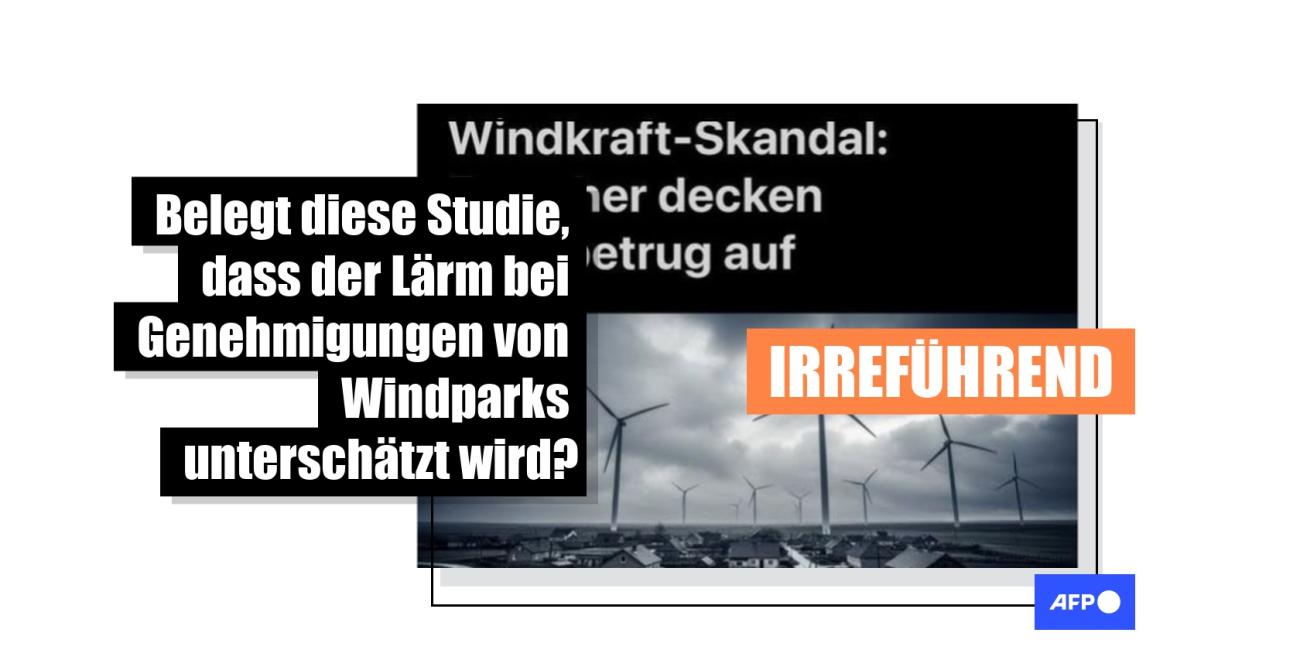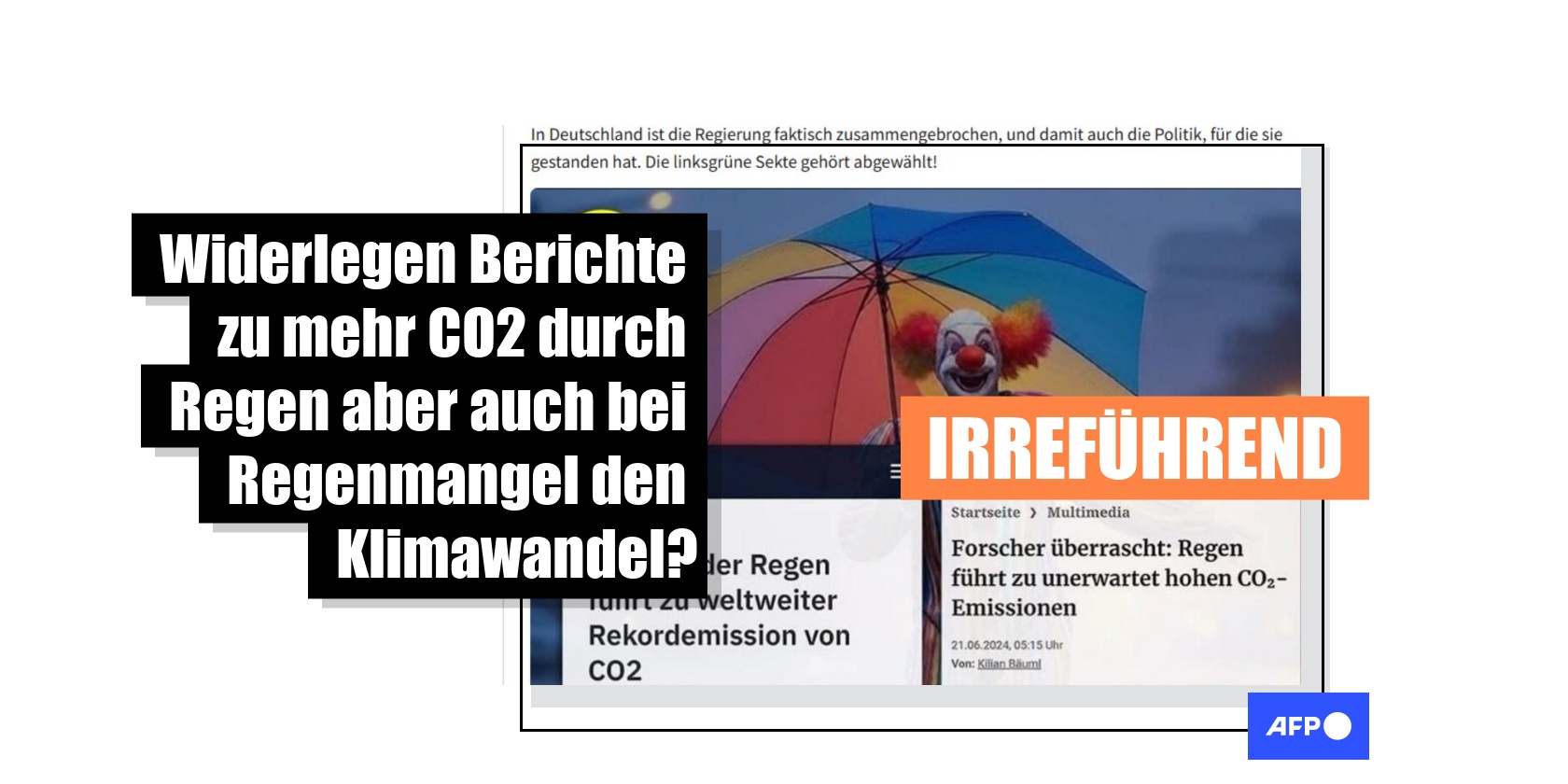
Wann ein Mangel von Regen CO2-Emmissionen verursacht – und wann der Regen selbst
- Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
- Veröffentlicht am 7. Februar 2025 um 13:36
- Aktualisiert am 10. Februar 2025 um 14:30
- 4 Minuten Lesezeit
- Von: Elena CRISAN, AFP Österreich
Zwei Berichte zur Auswirkung des Niederschlags in Form von Regen auf die Emissionen werden im Netz vielfach geteilt – allerdings zusammen mit einer Missinterpretation. "Regen führt zu hohen CO2-Emissionen, und mangelnder Regen führt auch zu hohen CO2-Emissionen", schrieb ein Nutzer im Juli 2024 auf Threads und teilte zwei Screenshots von Schlagzeilen zu Studienergebnissen. Die Behauptung kursiert aktuell erneut. "Klimawandel ist Quatsch!", hieß es in den Kommentaren eines Facebook-Beitrags vom 17. Januar 2025.

Die Winter werden feuchter, die Sommer trockener. Diese Veränderungen sind auf die Erderwärmung zurückzuführen. Die Forschung widmete sich der Frage, was das für den CO2-Ausstoß bedeutet.
AFP verglich die in sozialen Medien erwähnten Berichte gemeinsam mit Expertinnen und Experten und fand heraus, dass beide Ergebnisse gültig sind, weil sie unterschiedliche Phänomene beschreiben: Einerseits geht es um die Energiegewinnung, andererseits um einen Ökosystemeffekt, wie eine Sprecherin des Max-Planck-Instituts für Meteorologie am 23. Januar 2025 auf AFP-Anfrage präzisierte.
Wasserkraftwerke liefern weniger Strom bei weniger Regen
Die erste Schlagzeile, die aktuell in sozialen Medien geteilt wird, lautet: "Mangelnder Regen führt zu weltweiter Rekordemission von CO2" und wurde am 1. März 2024 auf der Website "weather.com" veröffentlicht. Gemäß mehrerer Medienartikel, die Informationen der Internationalen Energieagentur (IEA) zitieren, stieg der weltweite CO2-Ausstoß aus der Energieerzeugung wegen des besonders trockenen Sommers im Vorjahr auf einen Rekordwert. Demnach führte die extreme Trockenheit dazu, dass Wasserkraftwerke in den USA, China und anderen Ländern weniger Strom liefern konnten. Das habe einen Rückgriff auf fossile Energieträger nötig gemacht. Das Ergebnis: "40 Prozent des Anstiegs des CO2-Ausstoßes um 1,1 Prozent auf 37,4 Milliarden Tonnen im Jahr 2023 sei durch begrenzte Wasserkraft-Kapazitäten verursacht worden. Emissionen aus Kohle hätten mehr als 65 Prozent des Anstiegs ausgemacht", heißt es weiter in dem Bericht.
AFP fragte beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nach. "Ein Mangel an Niederschlag führt zu einer erhöhten Konzentration von Treibhausgasen", erklärte ein Sprecher am 21. Januar 2025 telefonisch. "Wenn Wasserkraftwerke dadurch weniger Leistung erbringen, muss das teilweise durch fossile Brennstoffe kompensiert werden." Dieser Effekt zeige sich hierzulande jedoch nur bedingt, da Deutschland nur in geringem Maße Energie aus Wasserkraft produziere.
Verrottung setzt Kohlendioxid frei
Die zweite Überschrift, die augenscheinlich im Widerspruch zum oben ausgeführten Artikel stehen soll, bezieht sich auf ein lokales Ereignis in der australischen Wüste. An einem bestimmten Ort, gelegen im Outback Australiens, "steigt mit dem Regen am Ende des Sommers die Konzentration von CO2 drastisch an", stand im Artikel, der in den geteilten Posts angeführt wurde. Dieser erschien im Juni 2024 auf der Website "merkur.de" und trug die Überschrift "Forscher überrascht: Regen führt zu unerwartet hohen CO2-Emissionen".
Das geht auf eine Studie zurück, an der mehrere Forscherinnen und Forscher weltweit beteiligt waren, darunter auch Fachleute der Universität Heidelberg sowie des Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Sie untersuchten trockene Regionen und ihren Einfluss auf "Variationen des globalen Kohlenstoffkreislaufs", wurde in einer Aussendung am 31. März 2023 festgehalten. Die Erkenntnis daraus: "Am Ende der Trockenzeit kommt es über dem australischen Kontinent zu jährlich wiederkehrenden CO2-Pulsen in der Atmosphäre." Die Analysen würden zeigen, dass Mikroorganismen aktiviert werden, wenn starke Regenfälle auf ausgetrocknete Böden treffen. Dann werde "besonders viel CO2 freigesetzt".
Das Team sprach in der Studie vom "Birch Effekt": Der Regen reaktiviere Bodenmikroben, die bei Trockenheit inaktiv seien. Diese würden sich vermehren, der Boden dabei Kohlendioxid absetzen. Da die pflanzliche Photosynthese erst später einsetze und somit am Ende der Trockenzeit kein Kohlendioxid gebunden werde, "kommt es zu dem sprunghaften saisonalen CO2-Anstieg". Dieses Phänomen erkläre, wie die Variabilität der Kohlenstoff-Flüsse vom Land in die Atmosphäre zustande kommen.
Unabhängig davon fange die Vegetation etwa zur selben Zeit an zu verwesen, wie der DWD-Sprecher erklärte. Das führe nach der Photosynthese zu weiterer Freisetzung von CO2. Diese Beobachtung bedeutet laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass trockene Regionen "einen größeren Einfluss auf die Variationen des globalen Kohlenstoffkreislaufs haben als bisher angenommen".
Victor Brovkin erklärte, dass mehr Regen langfristig gesehen "mehr Produktivität und mehr Kohlenstoffaufnahme" für Ökosysteme bedeute: "Mehr Emissionen aus den Böden am Ende der Trockenzeit werden in der Regel durch die Aufnahme während der Produktivitätssaison vollständig kompensiert", schrieb der Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Meteorologie auf AFP-Anfrage am 23. Januar 2025.
AFP erhielt am 23. Januar 2025 auch eine Einschätzung von Martin Jung vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Jung war an der Studie des Phänomens im australischen Outback beteiligt. Er bestätigte, dass die Emissionsschübe der Erde nach der Wiederbefeuchtung die Kohlenstoffbilanz "nicht wesentlich verändern". Er fügte hinzu, dass "der Kohlenstoff, der bei solchen Ereignissen oder Zeiträumen ausgeatmet wird, auch ausgeatmet würde, wenn der Regen gleichmäßiger verteilt wäre".
Die Studie habe dennoch ein "starkes Signal", weil sie zeige, dass "die mikrobielle Aktivität in der Trockenperiode unterdrückt wurde und mit der Wiederbefeuchtung startet". Da der Regen diese Ökosysteme antreibe, bedeute dies auch, dass "größere Regionen den Übergang von Trocken- zu Feuchtperioden etwa zur gleichen Zeit erleben".
Artikel beziehen sich auf unterschiedliche Effekte
Wasserkraftwerke in Industrieländern liefern bei extremer Trockenheit weniger Strom. Andererseits führt plötzlicher Niederschlag in der Wildnis Australiens zum Verfaulen der Vegetation – was wiederum CO2 ausstößt.
Beide Prozesse, "dass erstens weniger Regen irgendwo zu weniger Wasserkraft führt, die durch mehr Emissionen fossiler Brennstoffe kompensiert wird, und zweitens Regen am Ende der Trockenzeit zu vorübergehend mehr CO2-Emissionen aus den Böden führt", sind laut Victor Brovkin plausibel. "Diese geschehen unabhängig voneinander und hängen mit der Saisonalität und der interannualen Variabilität der Niederschläge zusammen", schrieb der Klimaexperte.
Die Wissenschaft ist sich überwiegend einig, dass die durch den Menschen verursachten Emissionen von Treibhausgasen – zu denen auch Kohlendioxid gehört – die globale Erwärmung auslösen. AFP hat bereits mehrfach Behauptungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel überprüft. Auf der AFP-Website sind alle Faktenchecks zum Thema Klima gesammelt.
Fazit: Im Netz kursierende Aussagen, dass sowohl ein Mangel an Regen als auch Regenfall selbst zu höheren CO2-Emissionen führe, stehen nicht im Widerspruch zueinander. Sie widerlegen auch nicht den Klimawandel, wie in den Posts suggeriert wird. Die Phänomene beziehen sich einerseits auf die Energiegewinnung aus Wasserkraft und andererseits auf lokale Beobachtungen in der australischen Wüste.
Rechtschreibfehler im 10. und Zeichensetzung im 11. und 14. Absatz korrigiert10. Februar 2025 Rechtschreibfehler im 10. und Zeichensetzung im 11. und 14. Absatz korrigiert
Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.